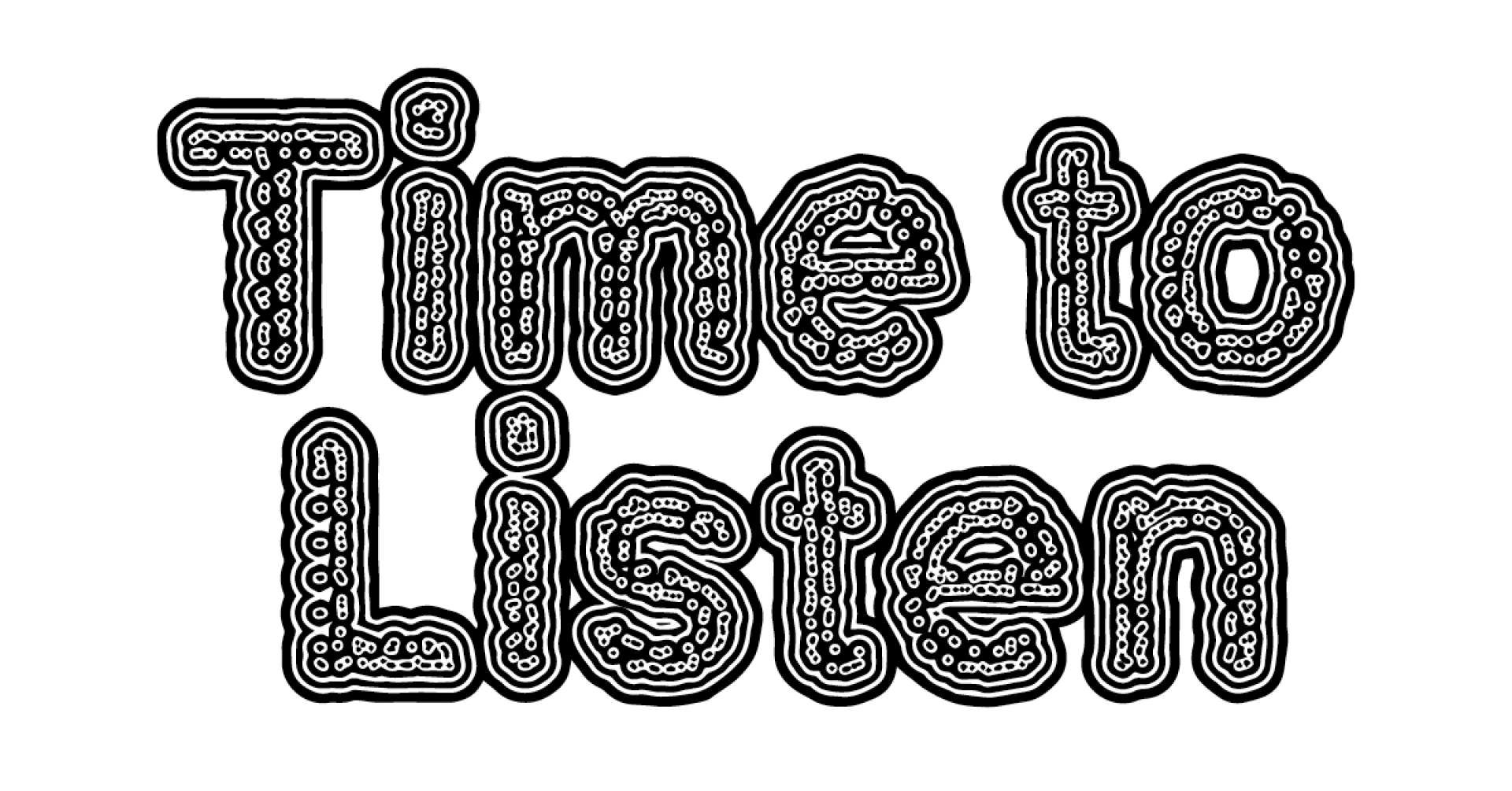Am 1. und 2. Oktober laden die inm / field notes und die Akademie der Künste zum dritten Teil des Symposiums »Time to Listen« zur Nachhaltigkeit in der zeitgenössischen Musik ein. In offenen Gesprächsrunden, künstlerischen Interventionen und Performances, einem gemeinsamen Essen und Fachvorträgen zwischen Musik, Politik und Wissenschaft richtet sich der Fokus dieses Jahr auf klangästhetische Ansätze zum Themenkomplex der Klima(un)gerechtigkeit.
Die Klimakrise ist global und doch treffen ihre Folgen nicht alle Menschen gleich: Länder des Globalen Südens tragen die Hauptlast der Umweltveränderungen, die sich in Überschwemmungen, Dürren, Ernteausfällen und kollabierenden Ökosystemen äußern. Auch innerhalb von Gesellschaften haben diskriminierte und marginalisierte Bevölkerungsgruppen weniger Möglichkeiten, sich den Klimafolgen anzupassen, weshalb die Klimakrise als Verstärker von sozialer Ungerechtigkeit wirkt. Gleichzeitig sind es gerade diese Länder und gesellschaftlichen Gruppen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen. Dennoch finden die Stimmen der am stärksten Betroffenen in der globalen Klimapolitik nur selten Gehör. Stattdessen geben in erster Linie die für die Klimakrise verantwortlichen Länder des Globalen Nordens den Ton an.
Bei dem Übergang unserer Gesellschaften zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft können Klang und Musik eine bedeutende Rolle spielen. Durch Praktiken des Hörens bzw. des Zuhörens können wir ein tieferes Verständnis von unserer sich stetig verändernden Umwelt vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen und unser Gehör auf jene menschliche und nicht-menschliche Akteure richten, die bislang überhört wurden. Klang und Musik können starke und konstruktive Narrative vermitteln und eine kollektive Vorstellung unserer Zukunft formen, die nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch fair und gerecht in einem globalen Kontext ist. Mit diesen thematischen Rahmen schlagen wir auch einen Bogen zu vorangegangen Symposien zur Dekolonisierung und Diversität in der neuen Musik.
Die einzelnen Sessions der Konferenz (Workshops, Sound Walks, Listening Sessions, Vorträge etc.) werden über einen Open Call ausgeschrieben, an dem sich bis zum 9. Juni 2024 beteiligt werden kann. Das vollständige Programm wird Anfang Juli veröffentlicht.
Während es bei der Konferenz »Time to Listen« explizit um künstlerische Ansätze geht, stehen bei der ergänzenden Workshopreihe »Community of Practice – Nachhaltigkeit in der zeitgenössischen Musik« praktische Fragen zur nachhaltigen Entwicklung in der zeitgenössischen Musikszene im Vordergrund. Im Frühling und Herbst 2024 kommen wir regelmäßig im Format der Community of Practice zu den Themen Mobilität (Touring und Publikumsbewegung), nachhaltige Festivalorganisation und Gestaltung von Projekträumen, Zertifizierung und Bilanzierung sowie Climate Handprint zusammen. Die Workshopreihe wurde gemeinsam initiiert, entwickelt und finanziert von der Ernst von Siemens Musikstiftung, dem Goethe-Institut, Impuls neue Musik, der inm / field notes, dem Musikfonds, ON Cologne, der Akademie der Künste und Art Music Denmark.
Akademie der Künste, Hanseatenweg
Di. 1. + Mi. 2. Oktober 2024